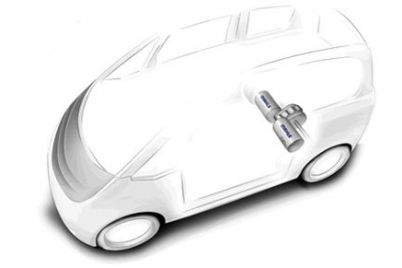Mit dem neuen Vorschlag der EU-Kommission könnten Millionen Fahrzeughalter in Europa bald häufiger zur Prüfstation müssen. Geplant ist, dass Autos ab dem elften Betriebsjahr jährlich zur technischen Kontrolle antreten. Begründet wird der Schritt mit Sicherheits- und Umweltaspekten. In Deutschland trifft der Vorschlag auf eine besonders breite Zielgruppe – das Durchschnittsalter der Pkw liegt hier bei über 11 Jahren.
Auswirkungen auf den deutschen Fahrzeugbestand
Rund 46 Prozent der in Deutschland zugelassenen Pkw sind älter als zehn Jahre. Diese Fahrzeuge müssten künftig jedes Jahr zur Hauptuntersuchung, sollte der Vorschlag der EU-Kommission in geltendes Recht überführt werden. Aktuell gilt in Deutschland nach der ersten Hauptuntersuchung (HU) im dritten Jahr ein zweijähriges Intervall, unabhängig vom Fahrzeugalter.
Die Einführung eines jährlichen Prüfzyklus hätte direkte Auswirkungen auf Kfz-Werkstätten und Prüfstellen. Eine deutlich erhöhte Nachfrage nach HU-Terminen wäre zu erwarten – verbunden mit einem potenziellen Mehraufwand in Logistik und Personalplanung. Für den Teilegroßhandel könnte sich daraus ebenfalls eine Verschiebung der Nachfrage ergeben, insbesondere im Bereich Verschleiß- und Prüfteile.
EU-Kommission verweist auf Unfallzahlen und Emissionen
Laut Angaben der EU-Kommission sollen durch die Maßnahme sowohl die Zahl technikbedingter Unfälle als auch der Schadstoffausstoß gesenkt werden. In Studien wurde festgestellt, dass ältere Fahrzeuge überdurchschnittlich häufig in Unfälle verwickelt sind und zudem eine größere Menge an Emissionen ausstoßen als neuere Modelle.
Ziel sei es, die Verkehrstoten EU-weit um etwa ein Prozent zu senken. Zudem verweist die Kommission auf bereits existierende nationale Regelungen in anderen Mitgliedsstaaten, wo regelmäßige Jahreskontrollen für ältere Fahrzeuge längst etabliert sind. Die Einführung eines einheitlichen Standards würde langfristig zur Harmonisierung innerhalb der EU beitragen.
Reaktionen aus der Branche
In Deutschland stößt der Vorschlag auf Skepsis. Der ADAC hält die Maßnahme für nicht erforderlich und verweist auf das bereits hohe Sicherheitsniveau deutscher Fahrzeuge. Technisch bedingte Unfälle seien vergleichsweise selten. Außerdem könne ein jährlicher Prüfzwang ältere Fahrzeuge wirtschaftlich unattraktiver machen – mit negativen Folgen für einkommensschwächere Fahrzeughalter.
Zwar würde eine jährliche Pflichtuntersuchung den Werkstätten mehr Aufträge bringen, doch steht der potenzielle Nutzen für die Verkehrssicherheit in Frage. Vielmehr wird befürchtet, dass zusätzliche Prüfkosten auf die Halter umgelegt werden, ohne dass daraus ein konkreter Sicherheitsgewinn entsteht.
Aus Sicht der Kfz-Werkstätten und dem Teilehandel sind es gut planbare Umsätze mit viel Potential weitere Dienstleistungen und Services zu verkaufen. Jedoch sei anzumerken, dass die Werkstatt-Auslastungen bereits recht hoch sind. Es wäre branchenweit Investitionen und Rekrutierungen von Fachkräften notwendig, um diese vielen neuen Prüfungen überhaupt realisieren zu können.
Politischer Prozess noch offen
Der Vorschlag der Kommission ist noch kein geltendes Recht. Zunächst muss er im Europäischen Parlament diskutiert und anschließend von den Mitgliedstaaten bestätigt werden. Der weitere Verlauf hängt von politischen Verhandlungen ab – auch davon, ob nationale Besonderheiten stärker berücksichtigt werden.
In Deutschland dürfte der Vorschlag auch zum Thema im Bundestag werden, insbesondere im Zusammenhang mit sozial- und klimapolitischen Fragestellungen.
Werkstätten, Prüforganisationen und der Teilehandel sollten die Entwicklung aufmerksam verfolgen und rechtzeitig auf mögliche Änderungen reagieren.
Fazit zum Vorschlag der EU-Kommission
Der Vorschlag der EU-Kommission zur jährlichen Pflichtinspektion für Fahrzeuge ab zehn Jahren hat das Potenzial, tiefgreifende Veränderungen im Kfz-Sektor auszulösen. Während die Maßnahme in Bezug auf Sicherheit und Emissionen nachvollziehbar begründet wird, ist die tatsächliche Notwendigkeit und Umsetzbarkeit in Deutschland umstritten. Die kommenden politischen Entscheidungen werden zeigen, ob sich der Vorschlag durchsetzt und wie er auf nationaler Ebene umgesetzt wird. Weitere Infos auf der Website der EU-Kommission. Bild: Pixabay